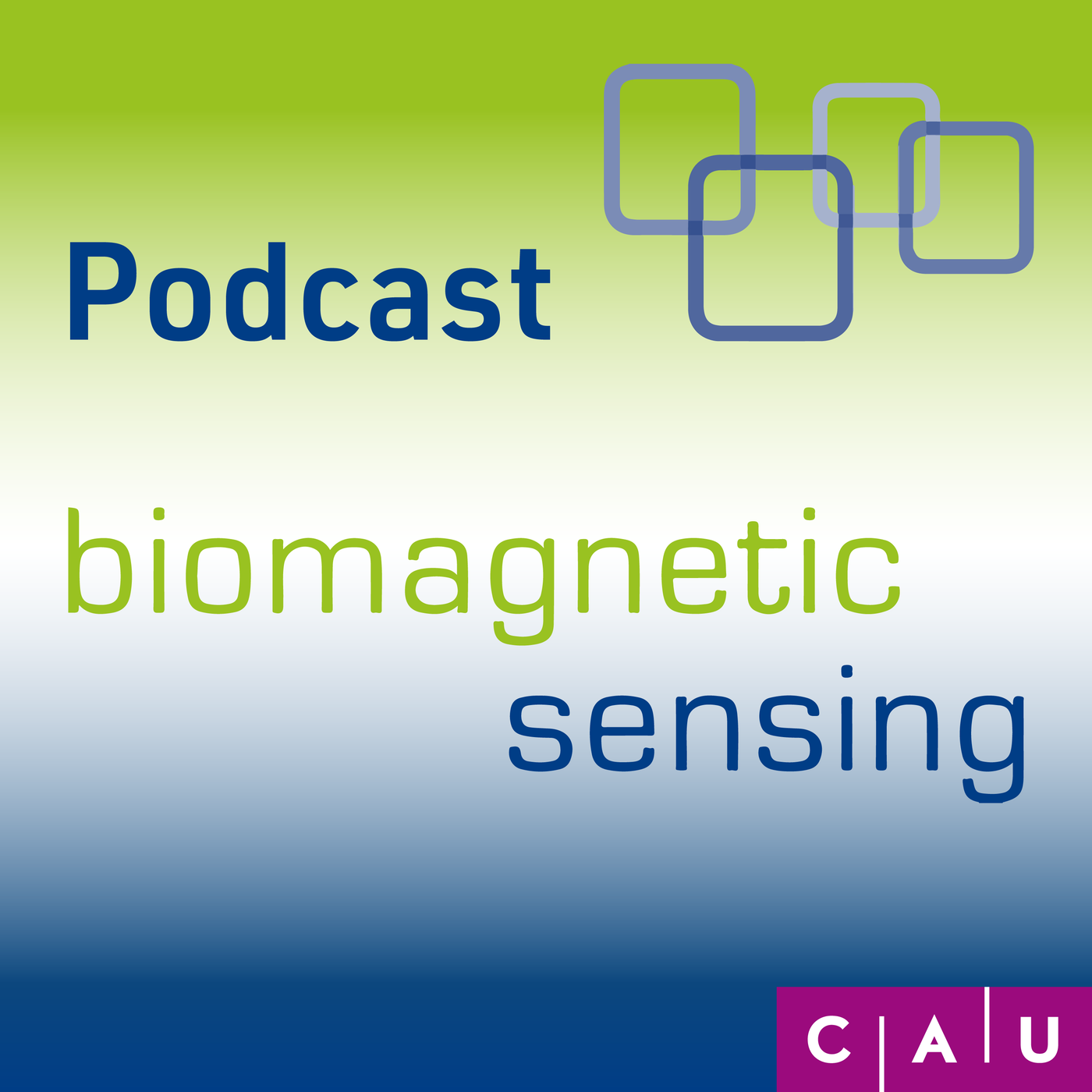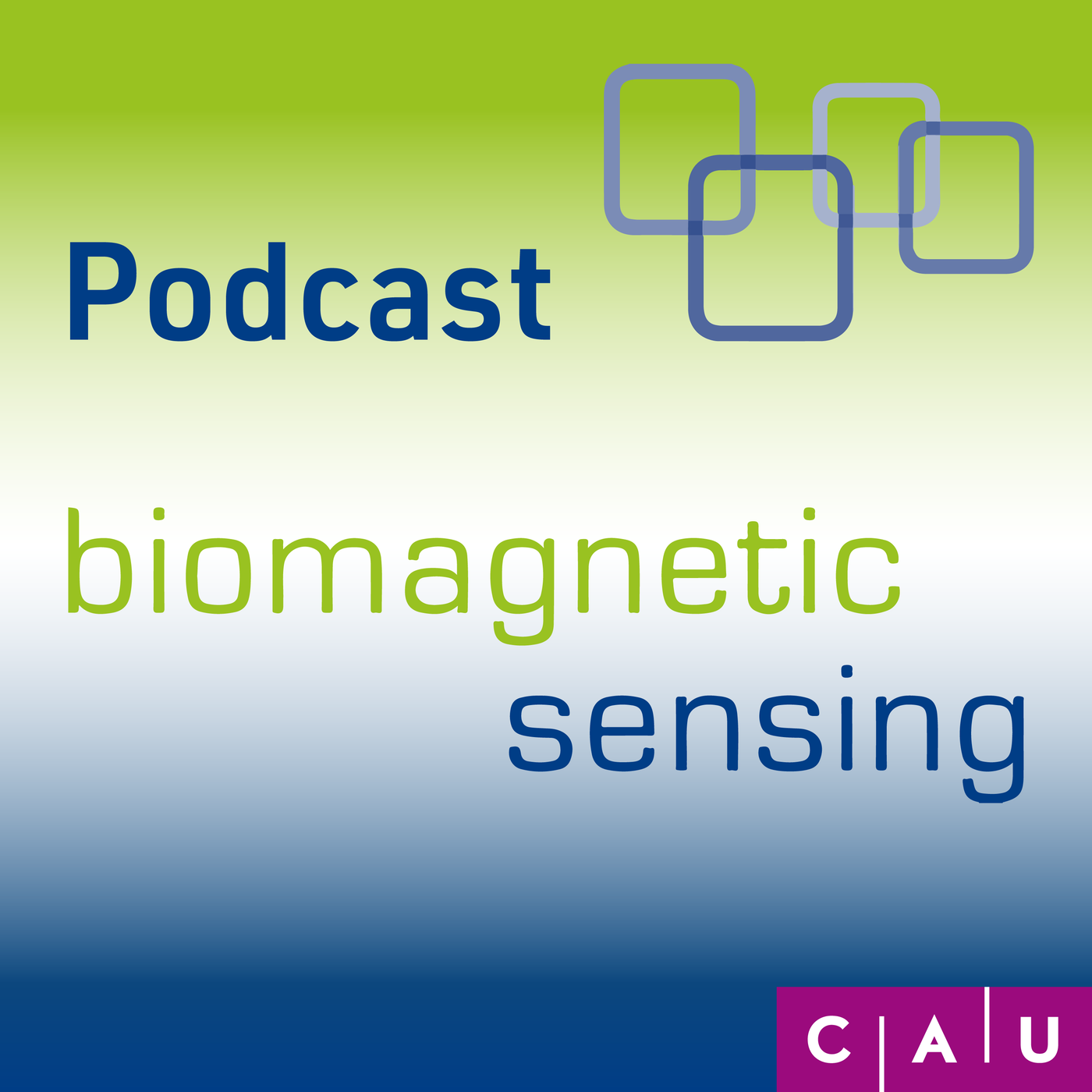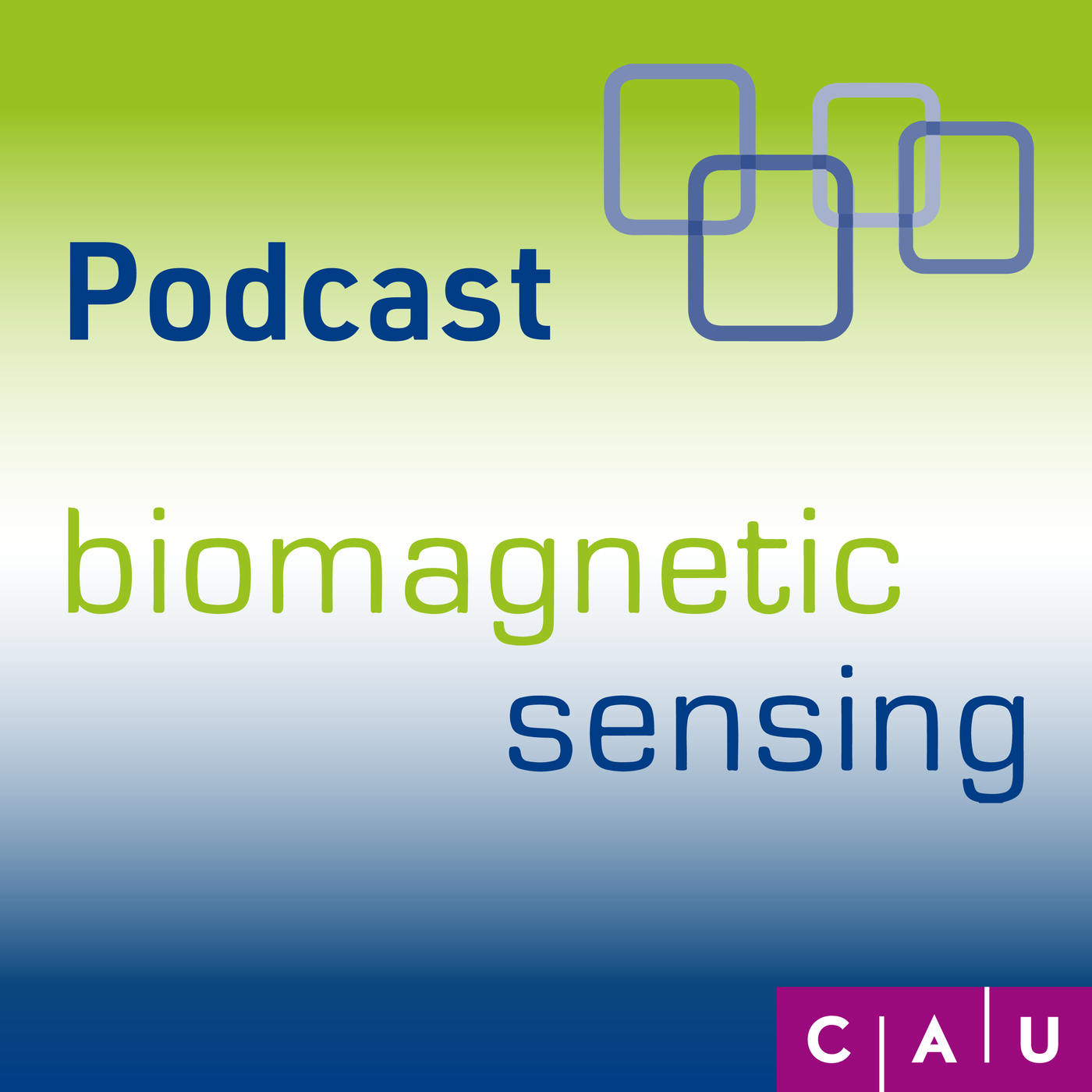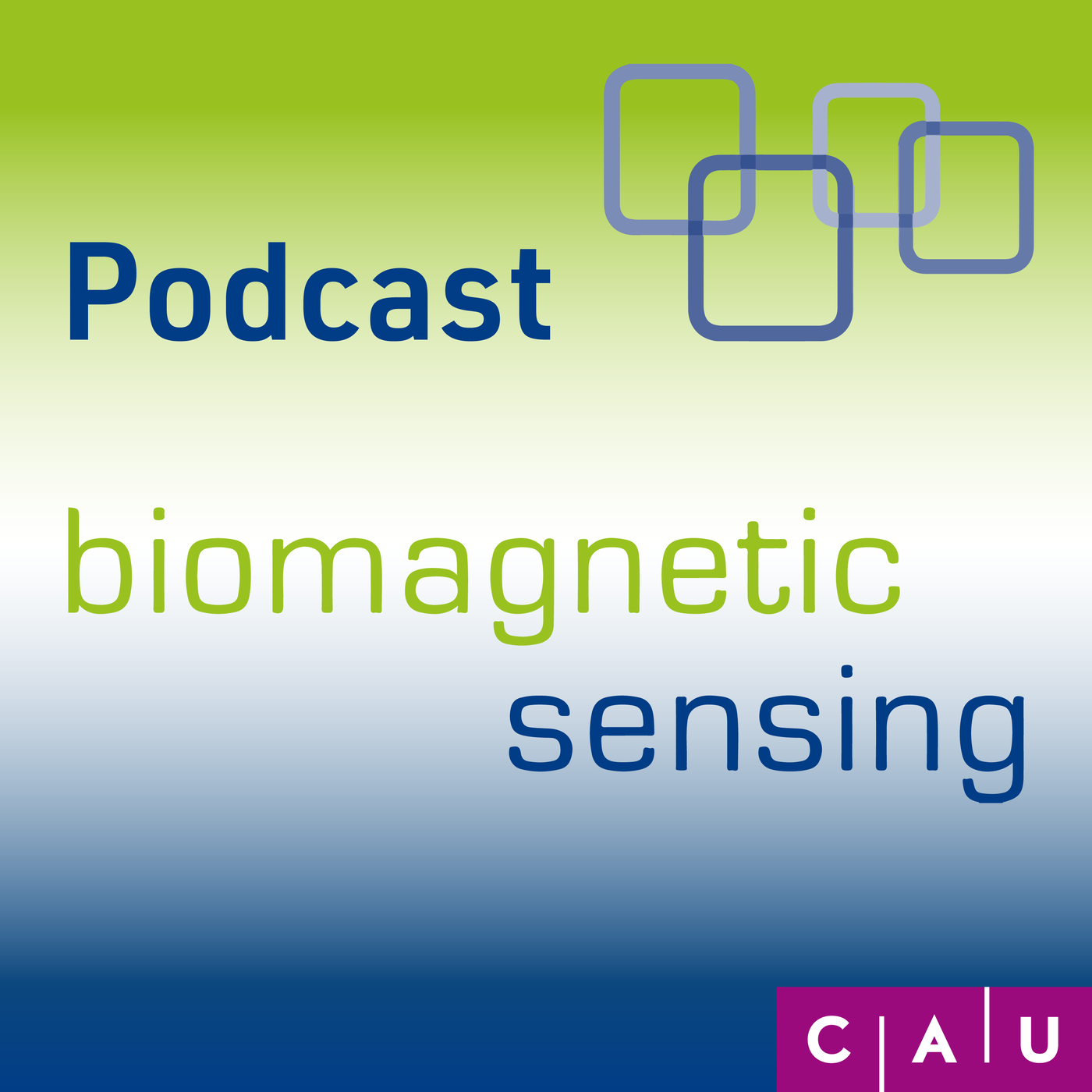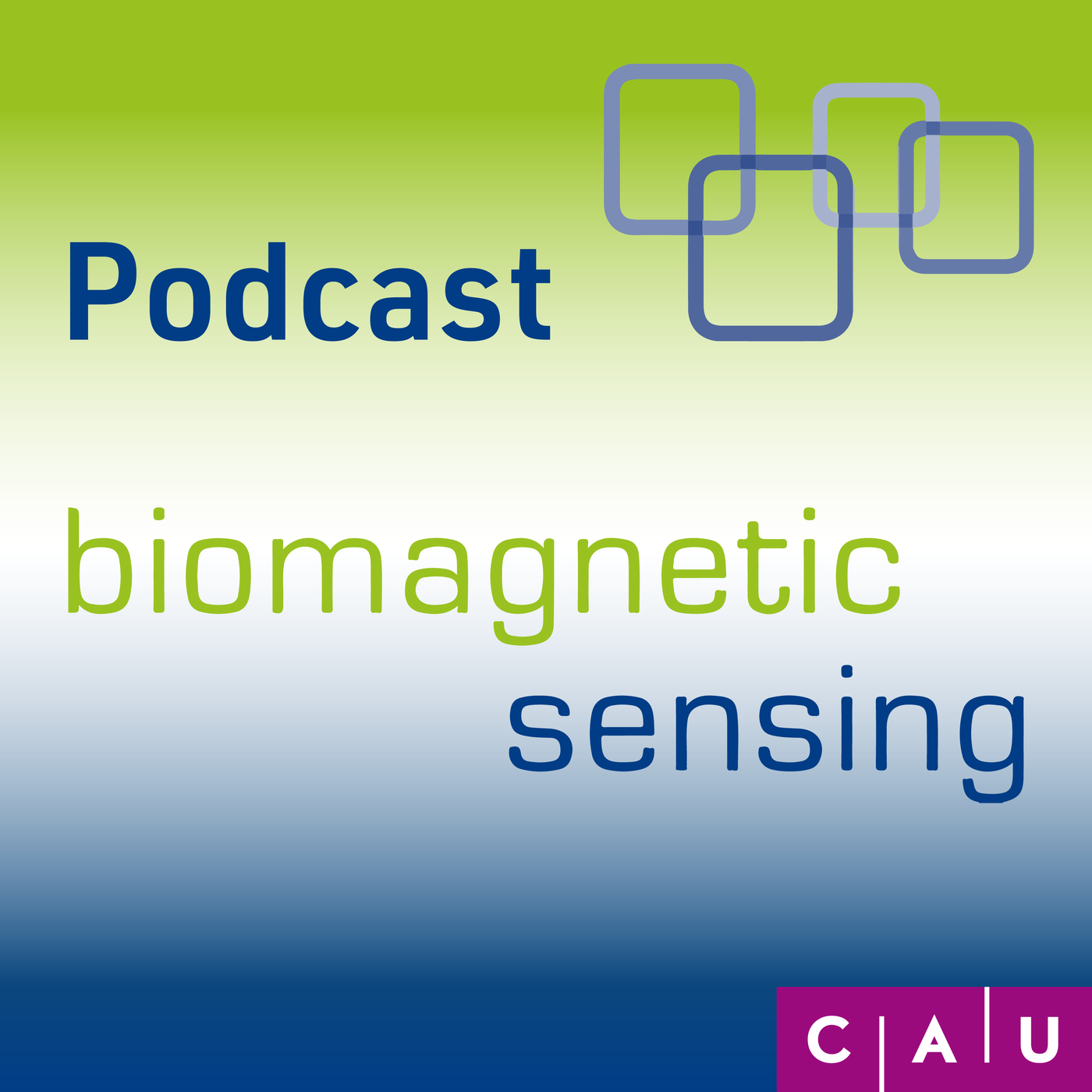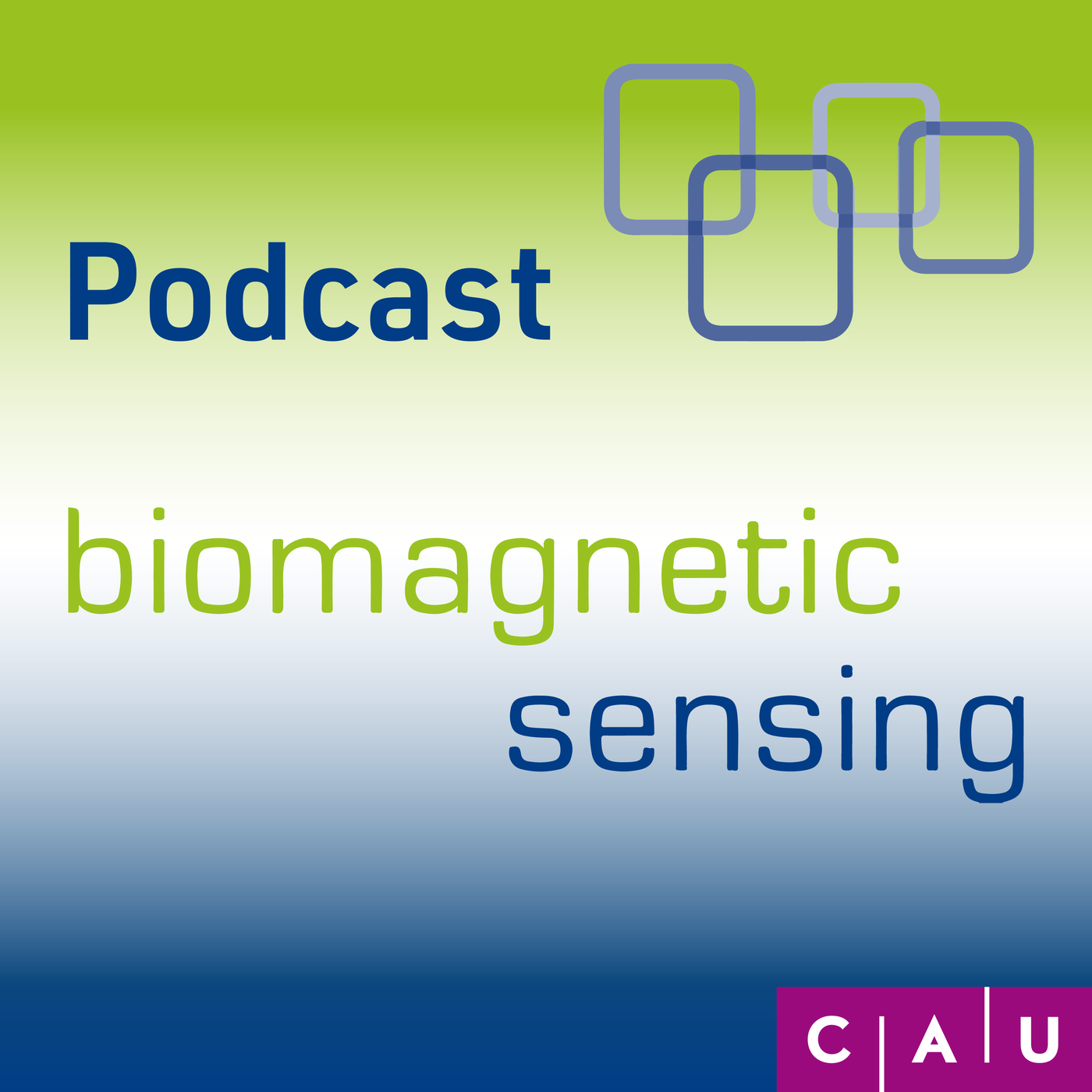
#18 Biomagnetic Sensing: Sonderforschungsbereich CRC 1261
In der letzten Folge der Podcastreihe geben die Experten Prof. Dr.-Ing. Eckhard Quandt und Prof. Dr.-Ing. Jeffrey McCord einen finalen Überblick über den SFB und nehmen uns nochmal mit in einzelne Teilbereiche: So endet die Reise mit einer Gesamtkarte. Außerdem diskutieren wir inwiefern Wissenschaftskommunikation zugenommen oder auch an Bedeutung gewonnen hat und ob Outreach in Zukunft bei Begutachtungen ein elementares Kriterium wird. Aber auch die Zukunft von Doktoranden*innen ist in einem interdisziplinären Forschungszusammenschluss von Bedeutung. Die Universität und am Ende auch die Wirtschaft haben natürlich Interesse an innovativen Ausgründungen mit neuen Technologien oder anderen visionären Ideen. Aber was passiert mit...